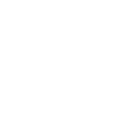Apolda
Apolda ist die Kreisstadt des mittelthüringischen Landkreises Weimarer Land im Städtedreieck mit Weimar und Jena. Im Nordwesten des Stadtgebiets fließt die Ilm. In der Raumordnung des Freistaates Thüringen nimmt die Stadt den Rang eines Mittelzentrums ein. Wikipedia
Bundesland: Thüringen
Aufgrund der mehr als 250-jährigen Tradition des Glockengießens ist die Mittelstadt bis heute überregional als „Glockenstadt" bekannt. Bedeutend ist auch die Strick- und Wirkwarenherstellung, die seit ebenfalls über 250 Jahren in Apolda betrieben wird.
Bundesland: Thüringen
Landkreis: Weimarer Land
Höhe: 205 m ü. NHNFläche: 46,15 km²
Bevölkerung: 23.386 (31. Dez. 2008)
Apolda war von 1922 bis 1950 eine kreisfreie Stadt und hat seit 1952 den Status einer Kreisstadt. Aufgrund der mehr als 250-jährigen Tradition des Glockengießens ist die Mittelstadt bis heute überregional als „Glockenstadt" bekannt. Bedeutend ist auch die Strick- und Wirkwarenherstellung, die seit ebenfalls über 250 Jahren in Apolda betrieben wird.
Ihren Aufschwung nahm die bis dahin kleine Ackerbürgerstadt, nachdem 1846 die Thüringer Bahn durch Apolda gebaut worden war. Die Textilindustrie wuchs rasant, und Apolda entwickelte sich zeitweise zur wichtigsten Industriestadt in Sachsen-Weimar-Eisenach. Von 1904 bis 1927 baute die Firma A. Ruppe & Sohn, die ab 1910 Apollo-Werke AG hieß, Automobile der Marken Apollo und Piccolo. In Apolda wurde die Hunderasse Dobermann gezüchtet, der hier ein Denkmal gesetzt wurde.
Geografische Lage und Geologie
Apolda liegt auf rund 205 Meter Höhe in der östlichen Mitte Thüringens an der Regionsgrenze zu Ostthüringen und etwa zehn Kilometer südlich der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Apolda ist mit einer Fläche von 46,17 Quadratkilometern in eine flachhügelige Kulturlandschaft am Rande des Thüringer Beckens und der Ilmaue mit überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung eingebettet und befindet sich im Städtedreieck Weimar–Jena–Naumburg. Die Stadt liegt jeweils rund 15 km nordwestlich von Jena und nordöstlich von Weimar, etwa 45 km östlich von Erfurt und 30 km südwestlich von Naumburg.
Der Stadtkern, der von zwei Bächen durchflossen wird, befindet sich in einem rechten Seitental der Ilm, eines Nebenflusses der Saale. Niedrigster Punkt des Tales ist mit 162 Metern über NHN die Sohle des Krebsbaches unter dem Viadukt. Der höchste Punkt befindet sich an der Gemarkungsgrenze zu Schöten mit 273,6 Metern über NHN.[4]
Der Schötener Bach entspringt im Ortsteil Schöten und fließt durch die Schötener Promenade in das Stadtzentrum, wo er am Heidenberg in den Herressener Bach mündet. Der Bach verläuft zwischen dem Eingang zur Promenade und dem Heidenberg unter einer Straße, die deswegen die Bezeichnung Bachstraße trägt.
Die Quelle des Herressener Bachs liegt oberhalb der Ortschaft Frankendorf. Der Bach durchquert sie und gelangt durch die Orte Oberndorf und Herressen-Sulzbach bis in das Zentrum Apoldas, wo er sich mit dem Schötener Bach vereinigt, bis nach Nauendorf fließt und dort in die Ilm mündet. Zwischen Frankendorf und Sulzbach trägt der Herressener Bach die Bezeichnung Sulzbach, zwischen dem Zusammenfluss mit dem Schötener Bach und der Mündung in die Ilm wird er Krebsbach genannt. Vom Herressener Bach zweigten zwei Mühlgräben ab: einer führte an der Stadtmühle vorbei, der andere verlief bis zur Niedermühle. Beide Gräben vereinigten sich später wieder mit dem Bach.
Östlich von Apolda erhebt sich mit der Muschelkalkformation der Jenaer Scholle der nordöstlichste Teil der Ilm-Saale-Platte, während westlich die Ebenen des Thüringer Beckens liegen. Die landschaftliche Gestaltung ist das Ergebnis von tektonischen Vorgängen bei der Gebirgsbildung und hat durch eine Störungszone einen graben- bis beckenartigen Aufbau. Die Entstehung der Apoldaer Störungszone ist vermutlich auf Abschiebungen im Untergebirge zurückzuführen. Die Bodendecke besteht aus Schwarzerde und lößartigem Auelehm unterschiedlicher Färbung. In den Talauen kommt mit Kies und Sand vermischter unterer Keuper vor. Nur in einem Streifen von Norden nach Westen ist das Pleistozän vorherrschend. Dort findet man vorwiegend älteren Lehm, wogegen im Süden der Stadt eher jüngerer Lehm vorhanden ist. Der Osten Apoldas wird vom Grenzdolomit geprägt.
Klimatische Verhältnisse
Apolda liegt in der gemäßigten Klimazone. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge von ungefähr 560 mm ist geringer als der bundesweite Durchschnitt von rund 800 mm. Der niederschlagsreichste Monat ist der Juni mit durchschnittlich 71,6 mm, der niederschlagsärmste der Februar mit durchschnittlich 31,5 mm. Der niederschlagsreichste Tag in Apolda war der 27. Juni 1953, als bei einem Unwetter 100,1 mm Niederschlag fielen. Das Jahr mit dem meisten Niederschlag war 1966 mit 764 mm, das mit dem wenigsten 1982 mit 332 mm. Die größte Monatsniederschlagshöhe wurde im Juni 1953 mit 236 mm erreicht, im Oktober 1943, im November 1953 und im September 1959 traten mit nur 1 mm die geringsten Werte auf. In Apolda fällt durchschnittlich an 170 Tagen im Jahr Niederschlag. Im Januar kommt es mit 16 Tagen am häufigsten und im September mit 12 Tagen am wenigsten zum Niederschlag. Im Durchschnitt werden pro Jahr in Apolda 36 Tage mit Schnee oder Schneeregen registriert. Im langjährigen Mittel fällt zu Beginn der dritten Novemberdekade der erste Schnee und Mitte April der letzte.
Über das Jahr verteilt scheint die Sonne 1400 bis 1600 Stunden. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 8–9 °C. Der Temperaturverlauf entspricht ungefähr dem bundesdeutschen Durchschnitt. Dabei sind die Monate Juli und August mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 24 °C die wärmsten, die Monate Dezember und Januar mit einer Maximaltemperatur von 3 °C und einer Minimaltemperatur von −1 °C die kältesten. Der Wind kommt meist aus Richtung Südsüdwest bis Westsüdwest.
1265, 1613, 1728, 1734, 1739, 1909, 1953 und 1981 kam es in Apolda zu Unwetterkatastrophen, die teilweise verheerende Folgen hatten. 1265 kamen viele Einwohner durch Überschwemmungen ums Leben. Am 29. Mai 1613 schwemmte die Thüringer Sintflut acht Häuser weg und 24 Tiere ertranken. 1830 stürzten nach einem Hochwasser in der Bachstraße drei Häuser ein. 1909 war der Marktplatz betroffen, er wurde in einen See verwandelt. Am 26. Juni 1953 richtete ein weiteres Unwetter schwere Schäden an. Der Ministerrat der DDR stellte 4,4 Millionen Mark zur Behebung der Schäden zur Verfügung. Der Herressener Bach wurde oberhalb des Stadtbades begradigt; vor dem Gelände der Brauerei am Wehrweg und in der Schötener Promenade unterhalb des zweiten Teiches wurden Prallmauern errichtet. Die Bachläufe erhielten eine Steinauskleidung. Vom bisher letzten Hochwasser am 16. Mai 1981 war vor allem die Straße Faulborn betroffen. Hier wurden einige Keller ausgepumpt, die Gehwege repariert und Stützmauern erneuert.
Allgemein ist das Klima verhältnismäßig warm und trocken. Wetterextreme wie Stürme, starker Hagel oder überdurchschnittlicher Schneefall sind selten. 2023 lag die Minimaltemperatur bei −8,5 °C und die Maximaltemperatur bei 35,7 °C.
Mittelalter
Ab dem 8./9. Jahrhundert ließen sich slawische Gruppen an der mittleren Saale und der Ilm nieder. Zu diesem Territorium gehörte das Gebiet der heutigen Stadt Apolda. Dieses Land an der Ostgrenze des Fränkischen Reiches war mehrheitlich von Thüringern, die sich aus Hermunduren und Turonen zusammensetzten, besiedelt.
Erstmals urkundlich bezeugt ist der Ort als Appolde 1119.[6] Es wurde eine Siedlung mit zwei Kirchen, der Martinskirche und der Sankt-Johannis-Kapelle, erwähnt, die Graf Wichmann aus dem Geschlecht der Edelherren von Querfurt dem Mainzer Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken schenkte. Der Name der Stadt kann als mittelhochdeutsche Bezeichnung für eine Gegend, in der es viele Äpfel gibt verstanden werden. Später wurde der Ort Apollde, Apolle, Apolleda oder Appulen genannt. Der mittelhochdeutsche Stadtname bestand aus den Silben Appul = Apfel und -(e)de = Gebiet. Vier Jahre später, 1123, wurde eine Burg mit einem in ihrem Schutz stehenden Dorf in einer Urkunde genannt, in der „Ditterich von Abbolde“ Erwähnung als Ministerialer fand.[7] Das Alter dieser Burg ist umstritten. Bisweilen wurde dort der Sitz der Grafen des Gaues Husitin vermutet, es gibt dafür keine Belege.
In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde die Burg Stammsitz eines Geschlechts von Ministerialen des Mainzer Erzbischofs, in dem die Ämter des Vicedominus von Erfurt und des erzbischöflichen Mundschenks erblich waren. Um 1175 teilte sich das Geschlecht in die beiden Linien der Vitzthume (abgeleitet von Vicedominus) und der Schenken von Apolda. Unter ihrer gemeinsamen Herrschaft entwickelte sich die Siedlung in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Stadt, deren Herren bis 1348 beide Linien blieben. Die Schenken von Apolda besaßen 1260 eine eigene Münzstätte. Die Münzen wurden Apoldsche Schenken genannt. 1289 erhielt die Burgsiedlung Apolda das Stadtrecht sowie ein eigenes Wappen und Siegel. Ihre Einwohner wurden in einer Urkunde als „Stadtbürger“ bezeichnet. Die Stadt wurde später ummauert und besaß zwei Tore.
1348 verzichteten die Schenken von Apolda zugunsten der Vitzthume auf ihre Rechte an der Stadt. Bald darauf, am Ende des 14. Jahrhunderts, starb die Linie der Schenken im Mannesstamme aus. Die Vitzthume ließen sich gleichzeitig von den Wettinern mit Apolda belehnen, wodurch die Oberlehnsherrschaft praktisch an die Wettiner überging. Infolge der Leipziger Teilung gelangte Apolda 1485 an das ernestinische Sachsen. Das Erzbistum Mainz hielt seine Ansprüche als Oberlehnsherrschaft noch einige Jahrhunderte aufrecht und gab sie erst 1666 auf.
In der Mitte des heutigen Marktplatzes wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts zunächst ein kleines Rathaus errichtet. Die älteste erhaltene Gemeindeverfassung entstand 1440; sie ist im sogenannten Roten Buch überliefert. Erst im 15. Jahrhundert hatte sich in der Stadt anstelle der Schultheißen der erste Rat der Stadt mit zwei Ratsmeistern, mehreren Ratsmännern und Viertelsmeistern gebildet. 1524 büßte die Burg bei einem großangelegten Umbau unter anderem die Sankt-Johannis-Kapelle ein.
Wissenswertes
Seidenspinnerraupen in Apolda
Das ungefähr 3 mm lange Seidenspinner Räupchen durchnagt die Eischale; …sofort kriecht es auf ein dargebotenes, Zartes Maulbeerblatt und beginnt zu fressen. In 4 Häutungsstadien wächst die raupe zur völligen Spinnreife heran. Dabei erhöht sie ihr Anfangsgewicht innerhalb eines Monats auf das sieben bis achtfache. Ihre Haut, ein starrer Chinin Panzer, wird während der Häutungen in bestimmten Zeitabständen jedes Mal durch eine erweiterte Hülle erneuert. Nur während der Häutungsstarre wird die Gefräßigkeit der Taupe unterbrochen. Die Raupe wird vot der Verpuppung auffallend unruhig; …Sie suchts sich jetzt einen Platz, um den Kokon zu spinnen. Der Kokonfadem entsteht aus zwei miteinander verklebten Einzelfäden, die den beiden Spinndrüsen entsprechen. In Unendliche vielen Schlingen bildet die Seidenraupe aus einem etwa 1500 bis 2000 Meter langen Seidenfaden das Schutzgehäuse, … den Kokon. Hierin vollzieht sich durch eine nochmalige Häutung die Umwandlung der Raupe zur Pupp, die das Übergangsstadium zum Schmetterling bildet. Nach etwa 20 Tagen sprengt der Schmetterling die Puppenhülle und durchbricht die Seidenwand des Kokons, die er vorher an er Durchbruchstelle mit einer Flüssigkeit erweicht hat. Durch Einströmen von Blutflüssigkeit versteifen sich allmählig die Flügel, die der Seidenspinner, selbst beim Liebesspiel, kaum mehr zu gebrauchen versteht. Das Weibchen legt etwa 400 bis 500 Eier ab. Sie gleiten durch die Legeröhre und kleben sofort an der Unterlage fest. Mit der Eiablage it der Kreislauf der Entwicklung geschlossen. Die Blätter der Maulbeere bilden die einzige Nahrung für den Seidenspinner. Überall da, wo Zäune, Hecken oder sonstige Einfriedungen Verwendung finden, könnte man die anspruchslosen Maulbeersträucher anpflanzen. So für Einfassungen von Garten- oder Feldwegen, Straßen und Alleen. Für Kleintierzuchtgehege, … als Schattenspender im Hühnerauslauf … und an Bahndämmen. Diese Maulbeerallee in Bad Pyrmont wurde schon zurzeit Friedrich des Großen angepflanzt. Für die Zucht genügen alle wenig genutzten Räumlichkeiten. Die einfachsten Schuppen oder Verschläge sind leicht für die kurze Zuchtperiode von etwa drei Sommermonaten einzurichten. Sämtliche Geräte für den Seidenbau kann sich der Züchter selbst anfertigen; … so die mit Drahtgeflecht bespannten Holzrahmen, … ebenso die Reihengestelle. Als Unterlage genügt zunächst festes, später gelochtes Packpapier. Die Raupen wechseln durch die Löcher hindurch von ihrem alten „abgegrasten“ Lager auf die mit frischen Maulbeerblättern ausgestattete neue und vergrößerte Lagerstätte über. Dabei lässt sich außerdem das Lager mühelos reinigen. Bis zur Spinnreife der Raupen muss für dauernde Ausdehnung der Lagerfläche gesorgt werden. Der Spinnrahmen wird eingesetzt. An der Stelle der Spinnrahmen können auch Strohbüschel oder einfach Heidekrautsträuße verwendet werden. Schon in 10 bis 12 Tagen nach dem Einspinnen können die Kokons „geerntet“ werden. Die gesamte Familie ist hier mit der Ernte beschäftigt. Was vor wenigen Wochen noch ein Briefpäckchen barg, füllt jetzt viele Säcke der Spinnhütte (Apolda) … mit lebenden Kokons. Mit dem Verkauf der Kokons an die Spinnhütte ist die ertragreiche Arbeit für den Seidenbauer beendet. Die Fabriken übernehmen nun die Weiterverarbeitung des wertvollen Rohmaterials. Zur Gewinnung des Seidenfadens werden die Kokons in Pfannen mit heißem Wasser gebracht, das den Klebstoff löst, der den fast 2 Kilometer langen Seidenfaden zusammenhält. Durch die ruckweise Bewegung der Bürste wird nach dem Faden getastet, bis die Borsten nach genügender Auflockerung die einzelnen Fadenanfänge erfasst haben. Jetzt erst lässt sich der Seidenfaden einwandfrei vom Kokon abwickeln. Die Stärke des aufgenommen Seidenfadens wird durch die Anzahl der Kokons bestimmt. Die fertig gezwirnten Fäden werden auf Spulen gerollt, um als wertvoller Rohstoff für die Wehrmacht und Industrie weiterverarbeitet zu werden.
Stadtverwaltung ApoldaMarkt 199510 ApoldaTelefon: +49 3644 6500Telefax: +49 3644 650400Tourist-Information ApoldaMarkt 1
99510 ApoldaTelefon: +49 3644 650100
Telefax: +49 3644 650518Was finde ich wo in Apolda?

Apolda
,
Hier könnt Ihr noch mehr Bilder sehen und mich als Euren Fotografen buchen
Internetseiten die ich betreue